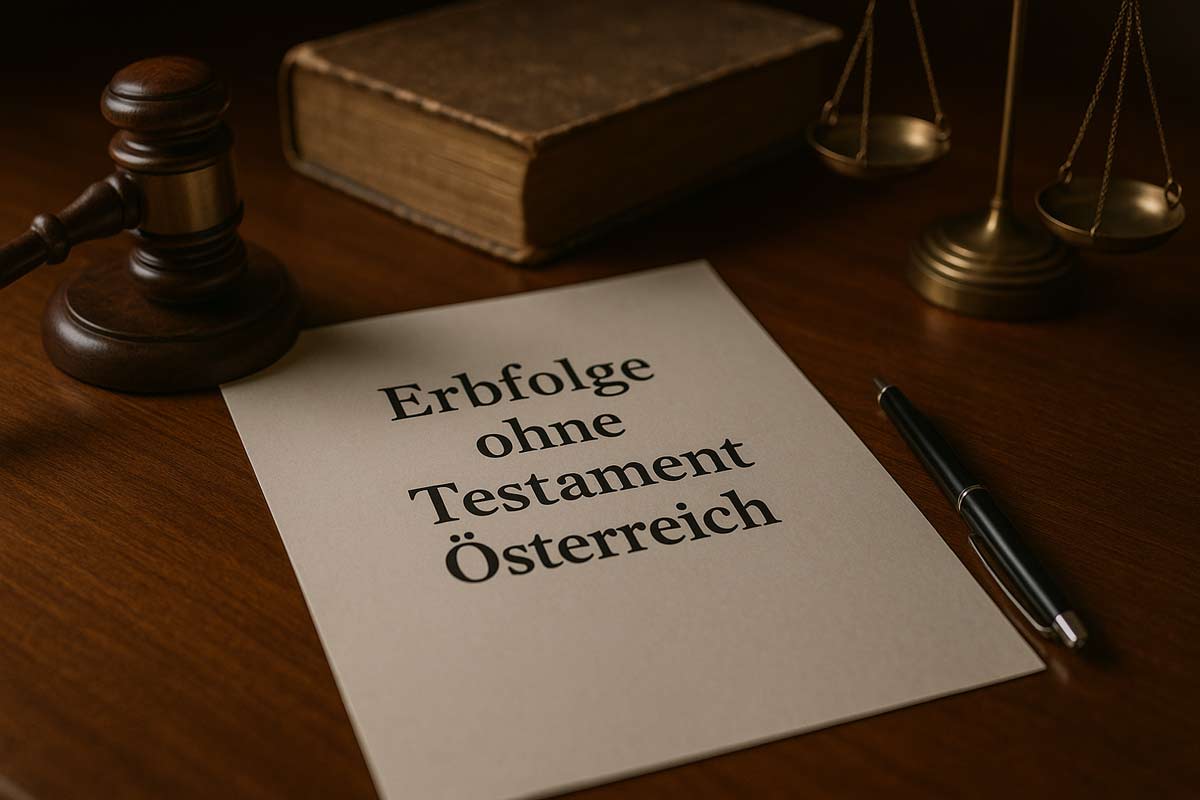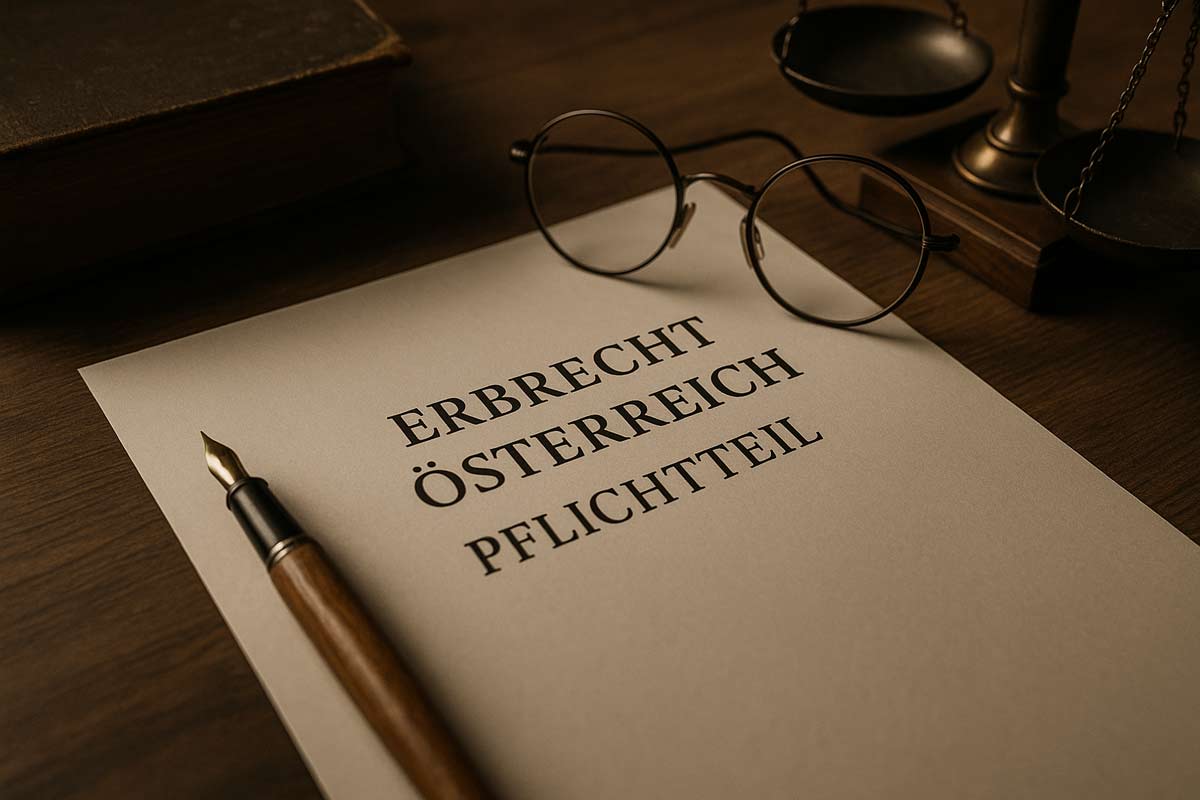Was geschieht mit Ihrem Vermögen, wenn Sie kein Testament hinterlassen? Das Thema „Erbfolge ohne Testament Österreich“ beschäftigt viele – sei es ganz plötzlich nach einem unerwarteten Todesfall, oder beim gemeinsamen Gespräch am Küchentisch. Aus unserer langjährigen Tätigkeit bei Trefalt und Walch Rechtsanwälte wissen wir: Die gesetzliche Erbfolge in Österreich regelt zwar vieles eindeutig, doch oft entspricht das Ergebnis nicht den familiären Wünschen. Manchmal kommt es sogar zu echten Überraschungen. Hier bringen wir für Sie Licht ins Dunkel: Wie läuft die gesetzliche Erbfolge ab? Wer hat Anspruch – und wer nicht? Wo lauern typische Fallstricke? Lesen Sie jetzt alles vom Anwalt für Erbrecht aus Feldkirch in Vorarlberg. Das Wichtigste zur Erbfolge ohne Testament in Österreich auf einen Blick Gesetzliche Erbfolge gilt automatisch, wenn kein Testament oder Erbvertrag vorliegt. Das Parentelensystem sortiert die Verwandtschaft und teilt nach starren Quoten auf. Ehepartner und eingetragene Partner bekommen besonderen Schutz, Lebensgefährten nur in Ausnahmen. Pflichtteilsansprüche lassen sich kaum ausklammern. Sonderregeln wie das Pflegevermächtnis bringen zusätzliche Ansprüche bei aufopfernder Pflege. Ohne Erben – ob gesetzlich oder durch Verfügung – erbt der Staat. Inhaltsverzeichnis Wann tritt die gesetzliche Erbfolge in Österreich ein? Das Parentelensystem: Wer erbt nach Gesetz? Ehegatten, eingetragene Partner und Lebensgefährten im Erbrecht Das Pflichtteilsrecht: Wer ist geschützt, wer nicht? Pflegevermächtnis: Anerkennung von Pflegeleistungen Außerordentliche Erbfolge und Aneignung durch den Staat Erbunwürdigkeit und Enterbung Gesellschaftsanteile und Unternehmensnachfolge Internationales Erbrecht und grenzüberschreitende Fälle Praxisbeispiele zur gesetzlichen Erbfolge Fazit: Gesetzliche Erbfolge in Österreich im Überblick Fragen zur Erbfolge ohne Testament in Österreich? Wir beraten Sie gerne. Wann tritt die gesetzliche Erbfolge in Österreich ein? Die gesetzliche Erbfolge springt immer dann ein, wenn es kein Testament oder keinen Erbvertrag gibt, ein testamentarisch verfügter Erbe seinen Anteil ausschlägt oder bereits verstorben ist, und auch, wenn nur ein Teil des Vermögens geregelt wurde – für alles andere springt das Gesetz ein. Merke: Das Erbrecht des Staates greift erst, wenn es überhaupt keine gesetzlichen oder sonstigen Erben gibt. Es genügt aber schon ein kleiner Fehler oder eine übersehene Person – und schon ändert sich die Verteilung. Das Parentelensystem: Wer erbt nach Gesetz? Die Reihenfolge der Erben folgt dem Parentelensystem. Es funktioniert wie ein einfaches Baumdiagramm – je näher die Verwandtschaft, desto früher bist du dran. Ganz praktisch läuft das so: 1. Parentel – Nachkommen: Hier kommen die Kinder, Adoptivkinder und Enkel an die Reihe. Jedes Kind erhält denselben Anteil. Ist ein Kind verstorben, rückt automatisch das nächste in der Kette (zum Beispiel die Enkel) nach. 2. Parentel – Eltern & deren Nachkommen: Gibt es keine Nachkommen, kommen die Eltern zum Zug. Sind auch sie verstorben, kommen die Geschwister (und anschließend Nichten, Neffen). 3. Parentel – Großeltern & deren Nachkommen: An diesem Punkt wird die Verwandschaftslinie schon etwas weiter: Onkel, Tanten oder Cousins und Cousinen – sofern keine Erben der ersten beiden Klassen da sind. 4. Parentel – Urgroßeltern: Ausschließlich die Urgroßeltern selbst. Weitere Nachkommen gehen leer aus. Ganz wichtig: Immer nur, wenn die vorherige Gruppe leer ausgeht, bekommt die nächste eine Chance. Adoptivkinder und uneheliche Kinder stehen eigenen Kindern übrigens vollkommen gleich. Ehegatten, eingetragene Partner und Lebensgefährten im Erbrecht Ehepartner und eingetragene Partner sind im österreichischen Erbrecht gleichgestellt und genießen besonderen Schutz. Mit Nachkommen (1. Parentel): Der überlebende Ehegatte oder Partner erhält ein Drittel des Nachlasses, während sich die Nachkommen zwei Drittel teilen. Mit Eltern (2. Parentel), aber ohne Nachkommen: Der überlebende Ehegatte oder Partner erhält zwei Drittel, die Eltern ein Drittel. Keine Nachkommen oder Eltern mehr am Leben: Der gesamte Nachlass geht an den überlebenden Ehegatten oder Partner. Befindet sich zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers ein gerichtliches Scheidungsverfahren zwar bereits in Gang, ist die Scheidung aber noch nicht rechtskräftig, steht dem Ehegatten dennoch das gesetzliche Erbrecht und das gesetzliche Vorausvermächtnis zu. Weicht jedoch ein Ehepakt oder eine sonstige Vereinbarung über die nacheheliche Aufteilung des Gebrauchsvermögens oder der Ersparnisse von der gesetzlichen Regelung ab, gelten ab Einreichung der Scheidungsklage die Bestimmungen dieser Vereinbarung (§ 746 Abs 2 ABGB). Und wie sieht es für Lebensgefährten aus? Wer ohne Trauschein zusammenlebt, hat es im Erbrecht in Österreich schwerer: Kein automatisches gesetzliches Erbrecht. Außerordentliches Erbrecht: Nur wenn überhaupt kein gesetzlicher Erbe existiert und der Lebensgefährte mindestens drei Jahre mit dem Verstorbenen in einem Haushalt gelebt hat, gibt es die Chance, doch zu erben. Wohnrecht für ein Jahr: Immerhin – die gemeinsame Wohnung bleibt dem Lebensgefährten für ein Jahr nach dem Todesfall erhalten. Das Pflichtteilsrecht: Wer ist geschützt, wer nicht? Das österreichische Erbrecht schützt direkte Angehörige vor völliger Enterbung. Sie behalten zumindest einen Pflichtteil, auch wenn sie im Testament nicht vorkommen: Plichtteilsberechtigt: Kinder (auch Adoptiv- und uneheliche), deren Nachfolger, Ehegatten und eingetragene Partner. Nicht pflichtteilsberechtigt: Lebensgefährten, Eltern, Geschwister oder andere Verwandte ohne Ehe oder Partnerschaft. Wie hoch fällt der Pflichtteil aus? Wer berechtigt ist, erhält die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. In der Praxis bedeutet das: Wird ein Kind im Testament übergangen oder enterbt, kann es trotzdem auf die Hälfte seines gesetzlichen Anteils pochen – es sei denn, es liegt ein triftiger Sonderfall vor (zum Beispiel eine besonders schwere Verfehlung). Der Pflichtteil ist mit Ablauf eines Jahres nach Tod des Erblassers fällig und muss erst dann ausbezahlt werden. Pflegevermächtnis: Anerkennung von Pflegeleistungen Engagement zahlt sich aus – zumindest, wenn pflegende Angehörige, Ehepartner oder Lebensgefährten mindestens sechs Monate in den letzten drei Jahren unentgeltlich gepflegt haben. Das Pflegevermächtnis ist eine faire Anerkennung: Zusätzlicher Anspruch: Die Höhe orientiert sich an den gesparten Pflegekosten. Wer zum Beispiel 20 Stunden monatlich nachweisen kann, bekommt einen entsprechenden Anteil obendrauf – oft ein nicht zu unterschätzender Wert! Voraussetzung: Die Pflege muss regelmäßig gewesen sein – mindestens 20 Stunden pro Monat. Das Pflegevermächtnis ergänzt Pflichtteil und Erbteil gleichermaßen – gerade für Töchter, Söhne oder Partner, die viel Zeit investieren, kann es einen echten Unterschied machen. Außerordentliche Erbfolge und Aneignung durch den Staat Kein Testament, keine gesetzlichen Erben, kein Lebensgefährte mit gemeinsamer Zeit – was passiert dann? In diesem seltenen Fall fällt das gesamte Erbe an die Republik Österreich. Praxistipp: Wer ausschließen will, dass nicht doch am Ende der Staat erbt, sollte frühzeitig Vorsorge mit einer letztwilligen Verfügung treffen. Gerade, wenn nahe
Erbrecht Österreich Pflichtteil
Erben bedeutet oft weit mehr als einen plötzlichen Geldsegen. Das Pflichtteilsrecht im Erbrecht Österreich hat die Aufgabe, die Familie zu schützen – und das selbst dann, wenn der letzte Wille anderes vorsieht. Das klingt nach Sicherheit, wirft aber oft zahllose Fragen auf: Was steht mir als Erbe oder Pflichtteilsberechtigter wirklich zu? Welche Fristen dürfen keinesfalls verpasst werden? Gibt es Wege, schon zu Lebzeiten Konflikten vorzubeugen und den eigenen Nachlass nach Wunsch zu gestalten? Dieser Leitfaden nimmt Sie mit auf eine Tour durch Möglichkeiten, Chancen und Fallstricke rund um Ihren Pflichtteil. Inhaltsverzeichnis Das Wichtigste zum Pflichtteil im Erbrecht Österreich auf einen Blick Wer ist pflichtteilsberechtigt? Wie hoch ist der Pflichtteil? Berechnung und Berücksichtigung von Schenkungen Pflichtteil: Fälligkeit, Fristen und Stundungsmöglichkeit Pflichtteilsverzicht, Erbverzicht und Enterbung: So vermeiden Sie Streit Spezialfälle: Unternehmensnachfolge, Immobilien und Patchworkfamilien Durchsetzung Ihres Pflichtteils – Darauf sollten Sie achten Nachlassplanung: Ihre Handlungsmöglichkeiten und Empfehlungen Fazit: Pflichtteilsrecht mit Weitblick nutzen Sichern Sie Ihre Rechte beim Pflichtteil mit trefalt-walch Rechtsanwälte Das Wichtigste zum Pflichtteil im Erbrecht Österreich auf einen Blick Wer ist pflichtteilsberechtigt? Nur Nachkommen, Ehepartner:innen und eingetragene Partner:innen haben einen fixen Anspruch. Höhe des Pflichtteils: Immer 50 % des gesetzlichen Erbanspruchs – gerechnet vom Nachlass nach Abzug aller Schulden und Kosten. Schenkungen: Die meisten Geschenke an Pflichtteilsberechtigte sind dem Erbe voll hinzuzurechnen; Schenkungen an Dritte zählen nur, wenn sie in den letzten zwei Jahren vor dem Tod erfolgten. Wann wird gezahlt? Der Anspruch entsteht sofort nach dem Todesfall, wird aber in der Regel erst ein Jahr später fällig. Stundungen sind möglich. Verzicht & Enterbung: Gibt es – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen und mit klaren Regeln. Wichtig bei: Betriebsnachfolge, vererbten Immobilien und Patchwork-Familien. Fristen: Wer Fristen übersieht, riskiert den kompletten Pflichtteil zu verlieren! Wer ist pflichtteilsberechtigt? Stellen Sie sich vor, eine Familie sitzt im Wohnzimmer, der letzte Wille liegt auf dem Tisch. Wer bekommt was – und wer kann leer ausgehen? Im österreichischen Erbrecht schützt das Pflichtteilsrecht die engsten Angehörigen besonders. Nach der großen Reform zählen hierzu: Kinder und ihre Nachkommen (Erbfolge per Stammfolge): Enkel und Urenkel erhalten den Pflichtteil nur dann, wenn der jeweilige Elternteil nicht mehr lebt. Ehegatten sowie eingetragene Partner:innen: Sie stehen Kindern beim Pflichtteil in nichts nach. Seit 2017 sind Eltern, Geschwister oder entferntere Verwandte vom gesetzlichen Pflichtteil ausgeschlossen. Damit rücken die Kernfamilie und der Lebenspartner in den Mittelpunkt. Praxis-Tipp: Auch wenn das wie eine Nebensache klingt – adoptierten und nicht ehelich geborenen Kindern steht das gleiche Recht wie leiblichen Kindern zu. Hier gibt es keinen Unterschied. Wie hoch ist der Pflichtteil? Berechnung und Berücksichtigung von Schenkungen Die Pflichtteilsquote bleibt fest: 50 % des gesetzlichen Erbteils. Klingt trocken? Mit einem Beispiel wird es klarer: Stellen Sie sich zwei Kinder ohne Ehepartner vor. Jedes Kind hätte einen gesetzlichen Anteil von 50 %. Der Pflichtteil je Kind macht davon die Hälfte aus, also jeweils 25 % des Nachlasswerts. So läuft die Berechnung ab: Nachlasswert feststellen: Alles wird einbezogen: Immobilien, Bargeld, Wertpapiere – davon abgezogen werden Schulden und Verfahrenskosten. Schenkungen hinzurechnen: Schenkungen an pflichtteilsberechtigte Familienmitglieder: Sie spielen immer eine Rolle – egal wann sie passiert sind. Sie sind dem Nachlass bei der Berechnung der Pflichtteilansprüche hinzuzurechnen. Schenkungen an andere: Nur relevant, wenn sie in den letzten zwei Jahren vor dem Tod erfolgten. Ein weiteres Detail: Ehepartner:innen dürfen sich über „Vorausvermächtnisse“ auf Haushaltsgegenstände und Wohnrechte freuen – zusätzlich zum Pflichtteil. Wer enterbt wurde, erhält keinen Pflichtteil. Der Pflichtteil kann zudem auf die Hälfte gemindert werden, wenn zwischen dem Verstorbenen und dem Pflichtteilsberechtigten zu keiner Zeit oder zumindest über einen längeren Zeitraum vor dem Tod des Erblassers ein Verhältnis, wie es zwischen solchen Verwandten üblicherweise besteht, bestanden hat. Der Verstorbene muss diese Pflichtteilsminderung zu seinen Lebzeiten testamentarisch angeordnet haben. Pflichtteil: Fälligkeit, Fristen und Stundungsmöglichkeit Ein Todesfall ist nie leicht. Umso wichtiger ist zu wissen, wann Ansprüche tatsächlich umgesetzt werden: Mit dem Tod entsteht automatisch der Pflichtteilsanspruch. Der Pflichtteilsanspruch wird erst nach einem Jahr ab Tod des Erblassers fällig. Und wie lange dürfen Sie Ihren Anspruch geltend machen? Die Verjährungsfrist („Kenntnisfrist“) liegt bei drei Jahren ab Kenntniserlangung des Pflichtteilberechtigten über alle Umstände. Dies bedeutet, dass er wissen muss, dass er pflichtteilsberechtigt ist und welche Umstände vorliegen, die zu seinem Anspruch führen. Spätestens nach 30 Jahren verjährt jedes Recht auf Pflichtteil endgültig. Frühestens tritt 3 Jahre ab Fälligkeit, somit 4 Jahre ab Tod des Erblassers Verjährung ein. Gut zu wissen: Unter bestimmten Bedingungen können Erben oder der Erblasser selbst eine Stundung der Auszahlung beantragen. Das Gericht kann so den Pflichtteil bis zu fünf Jahre hinauszögern, in besonderen Fällen sogar zehn. Gerade für Familienunternehmen kann das die Rettung bedeuten, damit der Betrieb reibungslos weiterläuft und nicht zu schnell Liquidität verloren geht. Während dieser Zeit fällt ein gesetzlicher Zinssatz (aktuell 4 % pro Jahr) an. Pflichtteilsverzicht, Erbverzicht und Enterbung: So vermeiden Sie Streit Pflichtteilsverzicht und Erbverzicht Vielleicht kennen Sie jemanden, der zugunsten eines Familienbetriebs auf einen Teil seines Erbes verzichtet hat und dafür eine Ausgleichszahlung erhielt. Genau das ist in Österreich möglich – vorausgesetzt, der Verzicht wird entweder beim Notar oder vor Gericht schriftlich festgehalten. Häufig gilt dieser Schritt übrigens nicht nur für den Einzelnen, sondern für die gesamte Linie der Abkömmlinge. So können Betriebe bewahrt oder Konflikte schon im Vorfeld gelöst werden. Enterbung Die Gründe müssen schwer wiegen: Wer den Erblasser oder dessen Angehörige erheblich schädigt – sei es durch Straftaten, enorme Verletzung der Familienpflichten oder massives seelisches Leid – kann enterbt werden. Seit einigen Jahren genügt schon ein anhaltender Kontaktabbruch (ohne berechtigte Gründe) für die Minderung des Pflichtteils. Das familiäre Näheverhältnis wird also nicht uneingeschränkt vorausgesetzt. Kleiner, entscheidender Hinweis: Ohne klare Begründung im Testament bleibt der Pflichtteilsanspruch bestehen – selbst bei Wunsch nach Enterbung. Spezialfälle: Unternehmensnachfolge, Immobilien und Patchworkfamilien Unternehmensnachfolge Pflichtteilsansprüche können Familienbetriebe in eine echte Zwickmühle bringen: Muss wirklich sofort an alle ausgezahlt werden, könnte der Betrieb zerschlagen werden. Die Stundungsregelung schafft hier Spielraum – gezielte Nachfolgeplanung, rechtzeitige Gespräche und möglicherweise ein Pflichtteilsverzicht sind Gold wert. Immobilien und Wohnungseigentum Insbesondere bei geerbten Immobilien entscheidet die richtige Bewertung – und die Frage, welche Schenkungen vorab gemacht wurden – über die Höhe der
Strafe bei Körperverletzung
Körperverletzung – allein das Wort löst schon viele Gefühle aus: Angst, Unsicherheit, oder vielleicht die Frage, wie es in solch einer Lage weitergeht. Ob als Betroffener oder Beschuldigte*r – schnell wird klar, dass die rechtlichen Folgen in Österreich nicht nur vielschichtig, sondern oft alles andere als leicht zu durchschauen sind. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt: Was gilt eigentlich als Körperverletzung? Wann drohen hohe Strafen – und wie sieht effektiver Schutz für Opfer wirklich aus? In diesem Beitrag finden Sie Antworten, die Klarheit schaffen. Wir nehmen Sie an die Hand, beleuchten die wichtigsten Körperverletzungsarten vom blauen Fleck bis hin zu lebensverändernden Fällen, geben Einblick in Strafrahmen und Schadenersatz und teilen Tipps, wie Sie Ihre Rechte – ganz gleich auf welcher Seite – aktiv vertreten können. Inhaltsverzeichnis Das Wichtigste in Kürze Was gilt als Körperverletzung? Definition und Formen Strafrahmen: Welche Strafen drohen bei Körperverletzung? Unterscheidung: Vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln Zivilrechtliche Ansprüche: Schadenersatz & Schmerzensgeld Strafprozess & Anzeige: Wie läuft das Verfahren ab? Verjährung bei Körperverletzung: Fristen und Ausnahmen Praktische Fallbeispiele: Was bedeutet das in der Praxis? Wann sollten Sie einen Anwalt einschalten? Fazit: Ihre Rechte und nächsten Schritte Jetzt rechtliche Beratung sichern – Ihr Recht auf erfahrene Unterstützung! Das Wichtigste in Kürze Österreichs Strafrecht macht klare Unterschiede: Art und Schwere der Verletzung, Handlungsunwert und die Folgen bestimmen die Strafe. Das Strafmaß reicht von straffrei bis zu 15 Jahren Haft – je nach Vorsatz des Täters und Folgen der Tat. Auch seelische Verletzungen können bestraft werden, geringfügige Beeinträchtigungen wie „blaue Flecken“ können in Einzelfällen straffrei sein. Opfer dürfen im Strafprozess auch direkt Ansprüche auf Schadenersatz und Schmerzensgeld fordern. Die wichtigsten Verjährungs-Fristen: 3 Jahre bei leichten, 5 Jahre bei schweren Fällen. Es gibt aber Ausnahmen, besonders bei sehr schweren Delikten. Was gilt als Körperverletzung? Definition und Formen Ein Moment der Unachtsamkeit, ein Streit, eine unüberlegte Handlung – Körperverletzung hat viele Gesichter. Immer dann, wenn jemand die körperliche Unversehrtheit oder die Gesundheit einer anderen Person beeinträchtigt, spricht man im Gesetz davon. Übrigens: Auch psychische Beeinträchtigungen stellen eine Körperverletzung dar, wenn sie Krankheitswert erreichen. Nach dem österreichischen Strafgesetzbuch (§§ 83–88 StGB) gibt es mehrere Hauptformen: (Leichte) Körperverletzung (§83): Kommt häufig vor, etwa bei Prellungen, kleineren Platzwunden oder Blutergüssen. Schwere Körperverletzung (§84): Darunter fallen Taten, die eine mehr als 24 Tage dauernde Seite 4 von 13 Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeiten zur Folge haben oder eine Verletzung bereits an sich schwer ist. Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§85): Zu denken ist etwa an den Verlust von Sinnesorganen oder Gliedmaßen sowie erhebliche Verstümmelungen oder auffallende Verunstaltungen. Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (§86): Die schwerste Folge: Das Opfer überlebt die Verletzung nicht. Absichtlich schwere Körperverletzung (§87): Dem Täter kam es geradezu darauf an, schwere Schäden zu verursachen. Fahrlässige Körperverletzung (§88): Entsteht durch Unachtsamkeit, wie es oft bei Autounfällen geschieht. Tipp: Nicht jede Schramme ist gleich eine Straftat. Nur geringfügige Beeinträchtigungen, die lediglich vorübergehend für Unbehagen sorgen oder das Abschneiden von Haaren, ist oft nicht strafbar. Kurzfristige, ganz leichte Spuren lassen das Strafrecht meist außen vor. Kontaktieren Sie jetzt Ihren Anwalt für Strafrecht. Strafrahmen: Welche Strafen drohen bei Körperverletzung? Welche Höchststrafen sieht das Österreichische Strafgesetzbuch vor? Das hängt davon ab, wie schwer das Opfer verletzt wurde und wie schwerwiegend die Schuld des Täters war. Damit Sie einen schnellen Überblick bekommen, hier die relevanten Strafdrohungen: Delikt Freiheitsstrafe Geldstrafe Besonderheiten Leichte Körperverletzung (§83 Abs 1 & 2) bis zu 1 Jahr bis zu 720 Tagessätze – Schwere Körperverletzung (§84 Abs 4) bis zu 5 Jahre – Berufsunfähigkeit >24 Tage, dauerhafte Schäden Schwere Dauerfolgen (§85 Abs 2) bis zu 10 Jahre – z.B. Verlust von Sinnesorganen Tödlicher Ausgang/absichtlich schwere KV (§86/87) bis zu 15 Jahre – besonders schwere Fälle Fahrlässige Körperverletzung (§88) bis zu 3 Jahre unter Umständen straffrei abhängig von Grad & Ausgang Körperverletzung an schutzwürdigen Berufsgruppen bis zu 2 Jahre – Kontrolleure, Rettungspersonal etc. Beachten Sie: Gerichte schauen auch immer darauf, wie die eigene Vorgeschichte aussieht, ob Reue gezeigt wird oder vielleicht sogar Notwehr mit im Spiel war. Das alles kann das Strafmaß sowohl nach oben als auch nach unten verschieben. Mit der richtigen Verteidigungsstrategie gelingt es uns häufig, einen niedrigeren Strafrahmen zu erwirken. Unterscheidung: Vorsätzliches, fahrlässiges oder gar straffreies Handeln Ob jemand absichtlich oder „nur aus Versehen“ handelt, entscheidet nicht selten über die Höhe einer Strafe. Wer gezielt verletzen möchte – also mit absichtlichem Vorsatz – muss mit deutlich härteren Strafen rechnen. Wer hingegen durch eine Unachtsamkeit, also nicht vorsätzlich, einen anderen am Körper verletzt, kommt in der Regel etwas glimpflicher davon. Fälle unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze: Eine kleine Hautrötung, die in wenigen Stunden vergeht, oder ein fast unsichtbarer blauer Fleck – derartige Symptome werden oft nicht als Körperverletzung qualifiziert. Wichtig: Psychische Gewalt verdient Aufmerksamkeit. Wenn ständiges Mobbing, Drohungen oder Stalking nachweislich die Gesundheit schädigen, greift ebenfalls das Gesetz – auch wenn keine sichtbaren Verletzungen vorliegen. Zivilrechtliche Ansprüche: Schadenersatz & Schmerzensgeld Körperverletzung trifft meist nicht nur physisch, sondern reißt auch in den Alltag und die Finanzen spürbare Lücken. Gerade deshalb stehen Opfern verschiedene Ansprüche zu, die Sie im Strafverfahren direkt geltend machen können – oft in einer besonders belastenden Zeit. Schadenersatz: Kosten für Heilung und Arztbesuche Verdienstausfall – wer nicht arbeiten kann, verliert oft Einkommen Umbaukosten, z. B. für barrierefreie Wohnungen oder Fahrzeuge Pflege, Betreuung und Unterstützung Fahrt- und Reisekosten, etwa zu Spezialkliniken oder Therapien Schmerzensgeld: Entschädigt für erlittene körperliche und psychische Schmerzen Auch Traumata und gravierende seelische Störungen werden berücksichtigt Wer wie viel bekommt, hängt ab von Dauer und Stärke der Schmerzen Gut zu wissen: Viele Ansprüche lassen sich direkt im Strafprozess als Privatbeteiligter einbringen – ein Weg, um schneller zu einer Lösung zu kommen. Reicht das trotzdem nicht aus, gibt es immer noch die Möglichkeit, später zivilrechtlich zu klagen. Ablauf des Strafverfahren: Wie läuft das Verfahren ab? Körperverletzungsdelikte sind Offizialdelikte. Hier muss die Staatsanwaltschaft handeln, sobald sie von der Tat erfährt – egal, ob betroffene Personen Anzeige erstatten. Gewisse Berufsgruppen (zB Seite 10 von 13 Ärzte, Richter) unterliegen einer Anzeigepflicht. Wenn diese Berufsgruppen Kenntnis von Körperverletzungen erlangen, müssen Sie Anzeige erstatten. Anzeige/Strafantrag (bei Antragsdelikt) oder behördliche Ermittlungen Polizei ermittelt nimmt